Hinter den Kulissen des European Hackathon Championship: ein Gespräch mit den Initiator:innen
Hinter den Kulissen des European Hackathon Championship: ein Gespräch mit den Initiator:innen
Woher kam die Idee für einen europaweiten Hackathon?
Adam Dziedzic: Alles begann mit zwei Hackathons, die wir in Polen mitorganisiert haben. Sie waren ein großer Erfolg. Danach haben wir mit vielen Menschen darüber gesprochen, und alle waren wirklich inspiriert von dem, was wir gemacht hatten. Unser Direktor war besonders begeistert von der Idee, mehr als nur einen Hackathon zu organisieren. So entstand die Idee, ein europaweites Hackathon Championship zu organisieren.
Franziska Boenisch: Wir sind mit dem Konzept von Hackathons, bei denen das Lösen von Aufgaben und der Wettbewerbscharakter im Vordergrund stehen, sehr vertraut, da wir genau so auch unsere Lehre gestalten. Wir halten es für wichtig, den Studierenden die Möglichkeit zu geben, das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen, da dies der beste Weg ist, zu lernen. In unserem Kurs über vertrauenswürdiges maschinelles Lernen an der Universität des Saarlandes gibt es viele praktische Aufgaben, die automatisch bewertet werden, und sogar eine Bestenliste. So können die Studierenden interaktiv miteinander konkurrieren und sehen, wie sie im Vergleich zu anderen abschneiden, was für viele sehr motivierend ist. Darüber hinaus sind alle Aufgaben, sowohl im Kurs als auch in den Hackathons, direkt an unsere tägliche Forschung angelehnt. Sie befassen sich mit aktuellen, realen Herausforderungen rund um vertrauenswürdiges maschinelles Lernen, die gerade jetzt von Bedeutung sind.
Einige der früheren Teilnehmenden des Hackathons in Polen kamen zu Euch ans SprintML Lab am CISPA. Wie war diese Erfahrung für euch?
Dziedzic: Das war eine der besten Erfahrungen, die wir mit Praktikant:innen gemacht haben. Sie waren tatsächlich die Gewinner zweier Hackathons in Polen, und das Praktikum am CISPA war einer der Preise. Durch den Hackathon waren sie bereits sehr gut vorbereitet und bereit, solche Aufgaben zu übernehmen. Dann kamen sie zu uns, um ihr Wissen in den Bereichen KI und Cybersicherheit zu vertiefen. Anschließend schafften sie es, ein Paper auf der ICLR, einer der renommiertesten Konferenzen im Bereich maschinelles Lernen, zu veröffentlichen. Sie haben großartige Arbeit geleistet! Während ihres Praktikums sind einige von ihnen auch nach China zur International Olympiad in Artificial Intelligence gereist. Die großartige Nachricht aus China war, dass einer von ihnen die Olympiade gewonnen hat, während zwei weitere eine Gold- und eine Silber-Medaille gewonnen haben.
Die Hackathon Championship ist eine europaweite Initiative. Was sind eure Ziele für dieses Projekt?
Boenisch: Wir möchten uns für vertrauenswürdiges maschinelles Lernen einsetzen. Maschinelles Lernen ist heutzutage überall: Es steckt in den Geräten, die wir benutzen, und ist ständig in den Nachrichten. Das Wichtigste ist, dass es vertrauenswürdig bleibt. Als Forschende verstehen wir, wie Vorhersagen zustande kommen. Wir wissen, dass sie nicht fehlerhaft sind, dass sie fair sind und dass unsere Daten sorgfältig behandelt werden. Wir müssen das Bewusstsein für dieses Thema schärfen und den Menschen die Möglichkeit geben, praktische Erfahrungen darin zu sammeln, wie man Modelle angreift und sie robuster macht. Genau dazu wollen wir die Leute ermutigen.
Dziedzic: Wir freuen uns sehr, dass viele Teilnehmende unserer Hackathons anschließend weiter an diesen Themen arbeiten und künftig Teil des CISPA werden möchten. Es ist sehr befriedigend für uns zu sehen, dass immer mehr Menschen sich für diese Bereiche interessieren und an diesen Themen forschen.
Ein Hackathon besteht darin, innerhalb von 24 Stunden bestimmte Aufgaben zu lösen. Inwiefern qualifiziert das jemanden für die Arbeit als Nachwuchsforscher:in?
Dziedzic: Wir möchten, dass die Teilnehmenden wirklich verstehen, worum es in unserem Forschungsfeld geht. Durch diesen 24-stündigen Deep Dive können sie das Thema intensiver erkunden und herausfinden, ob es etwas ist, das sie wirklich weiterverfolgen möchten. Wir sehen das als den ersten Schritt in die Forschungsbereiche der KI und des vertrauenswürdigen maschinellen Lernens.
Boenisch: Ich würde auch sagen, dass ein Hackathon Forschungskompetenzen erfordert. Man bekommt eine Aufgabe gestellt und weiß zunächst nicht, wo man anfangen soll. Der erste Schritt besteht darin, zu recherchieren, wie andere in der Vergangenheit ähnliche Probleme gelöst haben. Dann passt man diese Ansätze an die eigenen Bedürfnisse an. Genau das tun auch unsere Doktorand:innen täglich. An genau solchen Problemen zu arbeiten, ist das, was man später während der Promotion ebenfalls macht: Man hat ein Projekt, untersucht alle möglichen Lösungswege und wählt schließlich den bevorzugten Ansatz um ihn bis zum Ende zu verfolgen. Ich denke, ein Hackathon ist eine großartige Möglichkeit herauszufinden, ob man Forschung mag – aber auch, um zu entdecken, wie das Leben als Forscher:in aussehen kann.
Könntet ihr uns ein wenig über die Arten von Aufgaben erzählen, die die Teilnehmenden während des Hackathons lösen müssen?
Dziedzic: Wir entwerfen die Aufgaben auf der Grundlage unserer Forschung. In der Regel versuchen wir, bestimmte Teilbereiche unserer Arbeit herauszuarbeiten, die sich gut für einen 24-Stunden-Sprint eignen. Es ist sehr wichtig, dass diese Aufgaben leicht zugänglich sind. Sobald jemand eine Aufgabe gelöst hat, wird die Lösung an unsere Server gesendet, wo sie mit anderen Lösungen verglichen werden kann. Außerdem möchten wir, dass die Studierenden Spaß daran haben, diese Aufgaben zu lösen, indem sie an wirklich hochaktuellen Themen arbeiten. Das Ziel ist, dass sie durch unsere Aufgaben KI einmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen.
Boenisch: Eine der Aufgaben, die ich persönlich am spannendsten finde, basiert tatsächlich auf Adams Forschung. Dabei geht es um das sogenannte Model Stealing. Viele Machine-Learning-Modelle werden als Dienstleistung angeboten, um über eine API Vorhersagen zu treffen. OpenAI zum Beispiel stellt eine solche API bereit, für deren Nutzung man bezahlt. Das bedeutet, dass man kein eigenes Modell trainieren muss. Adams Forschung hat gezeigt, dass solche Modelle über die API „gestohlen“ werden können. Man muss das Modell nur abfragen und kann durch die Analyse seiner Antworten eine eigene lokale Kopie erstellen und diese sogar anpassen. Genau das ist eine der Aufgaben, die wir den Studierenden stellen. Wir entwickeln unser eigenes Modell, stellen eine offene API zur Verfügung und sagen ihnen: „Stehlt es!“. Am Ende vergleichen wir dann, wie ähnlich ihr Modell unserem ist. Das ist für die Teilnehmenden eine großartige Erfahrung, weil sie sehen, dass so etwas in der realen Welt tatsächlich passieren kann.

©CISPA/David Rohner
Habt ihr selbst während eures Studiums an einem Hackathon teilgenommen? Wenn ja, wie war das für euch?
Dziedzic: Ja, für mich war es eine wirklich großartige Erfahrung. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, 24 Stunden am Stück aktiv zu sein. Danach waren wir zwar völlig erschöpft, aber es hat uns viel Freude bereitet, gemeinsam Rätsel zu lösen. Außerdem sahen wir es als Gelegenheit, unser Team aufzubauen. Die Möglichkeit, die eigenen Kolleg:innen besser kennenzulernen, ist einfach fantastisch. Einer meiner Freunde und ich haben an einem Hackathon teilgenommen, aus dem später die Idee für ein kleines Startup entstanden ist. Durch Hackathons können wir engere Verbindungen aufbauen, mit Spaß Probleme lösen und vielleicht aus den ersten Ideen etwas Größeres entwickeln.
Boenisch: Ich persönlich habe nie an einem Hackathon teilgenommen. Es gab zwar einige Angebote, aber keine zu Themen, die mich wirklich interessiert hätten. Deshalb ist das jetzt der erste KI-orientierte Hackathon, den wir organisieren. Genau deswegen bin ich so begeistert davon. Als Studentin hätte ich mir gewünscht, so etwas erleben zu können.
Die Erfahrungen bei den Hackathons in Warschau und Krakau waren großartig. Natürlich sind wir über Nacht geblieben. Man ist ständig von Menschen umgeben, isst Pizza zu Mittag, zum Abendessen und zum Frühstück und kann danach wochenlang keine Pizza mehr sehen. Man ist müde, aber glücklich, dass alles so gut läuft. Um ehrlich zu sein: Es macht einfach riesigen Spaß.
Dziedzic: Ich würde sagen, es gibt durchaus Parallelen zur Forschung. Auch in der Forschung haben wir oft enge Deadlines, meistens zu unmöglichen Uhrzeiten, wie etwa um 7 Uhr morgens. In der Realität ist das Paper meist erst kurz vor der Abgabefrist fertig. Daher arbeiten wir oft die ganze Nacht durch – zusammen mit unseren Studierenden, die mit uns im Büro bleiben. Es fühlt sich mittlerweile fast so an, als hätten wir kleine Hackathons im Büro, bevor die Deadlines für die großen Machine-Learning-Konferenzen anstehen.
Dieser Hackathon wird in sechs europäischen Universitätsstädten stattfinden. Seid ihr auch persönlich vor Ort?
Dziedzic: Ja, natürlich! Wir werden da sein und freuen uns auf die Begegnungen mit den Studierenden. Außerdem werden wir als Mentor:innen dabei sein, um ihnen zu helfen, aus der Erfahrung zu lernen und uns kennenzulernen. Sie sind immer sehr neugierig, jemanden zu treffen, der in diesem Bereich arbeitet, und haben viele Fragen: nicht nur zu den Aufgaben, sondern auch zur Forschung im Allgemeinen. Manchmal helfen wir ihnen sogar bei der Lösung der Aufgaben. Wir sind sehr praxisorientiert: Wir gehen hin, sprechen mit ihnen, diskutieren die Aufgaben, brainstormen und schreiben sogar gemeinsam Code. Die Teilnehmenden schätzen es sehr, dass wir 24 Stunden lang mit ihnen durchhalten.
Neben eurer eigenen Forschung und der Betreuung von Doktorand:innen habt ihr auch noch drittmittelgeförderte Projekte und jetzt zusätzlich den Hackathon zu koordinieren. Es scheint, als würdet ihr nie aufhören zu arbeiten. Wie schafft ihr es, all das unter einen Hut zu bringen?
Boenisch: Es ist schwierig. Es gibt wirklich viel zu jonglieren. Ehrlich gesagt würde es nicht funktionieren, wenn wir nicht auch an Wochenenden und Abenden arbeiten würden. Aber das Thema ist so vielfältig, und wir sind unglaublich begeistert davon. Forschung zu betreiben und das Labor zu leiten, macht großen Spaß. Und mit dem Hackathon haben wir das Gefühl, etwas für zukünftige Generationen zu bewirken. Deshalb ist es die Mühe auf jeden Fall wert, und genau das motiviert uns so sehr. Andernfalls wäre es wohl kaum zu schaffen.
Dziedzic: Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Das ist etwas, das wir wirklich mit Leidenschaft tun. Für uns ist es nicht einfach ein Beruf, es ist mehr als das: Wir haben das Gefühl, dass wir eine Mission haben. Wir wollen das Feld der KI weiterentwickeln und die nächste Generation von Forschenden ausbilden. Wir gehen jeden Morgen gerne mit unseren Studierenden ins Büro. Sie sind unsere Freund:innen, und wir sehen sie als Menschen, die gemeinsam mit uns wachsen und KI besser, sicherer und vertrauenswürdiger machen wollen. Dieses gemeinsame Ziel treibt uns alle an.
Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit dem Projekt!
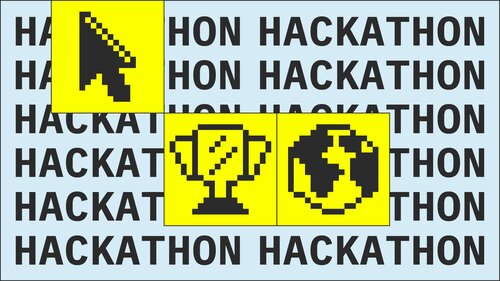
Über die Hackathon Championship
Die CISPA European Cybersecurity & AI Hackathon Championship ist ein europaweiter Wettbewerb, der von November 2025 bis Juni 2026 vom CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit organisiert wird. In regionalen Vorentscheiden in großen europäischen Universitätsstädten treten Bachelor- und Masterstudierende in Teams von bis zu vier Personen an, um innerhalb von 24 Stunden Herausforderungen aus den Bereichen KI und Cybersicherheit zu lösen. Die Gewinner:innen der einzelnen Städte qualifizieren sich für das große Finale in St. Ingbert, wo sie um Geldpreise, Trophäen und Zertifikate konkurrieren. Durch die Zusammenführung junger Talente aus ganz Europa soll diese Meisterschaft nicht nur Innovation und Kompetenzen in vertrauenswürdiger KI und Cybersicherheit fördern, sondern auch eine gesamteuropäische Gemeinschaft aufbauen, die sich der Sicherung unserer digitalen Zukunft verschrieben hat.